Die unterschätzte Gefahr: Mobiltelefone, Tablets, E-Reader, Kinderspielzeug, E-Zigaretten, Ladegeräte, Steckerleisten, E-Scooter und -Bikes – die Anzahl der elektronischen Geräte in unseren Haushalten und Betrieben nimmt laufend zu.
Damit einhergehend nehmen aber nicht nur die persönliche Freiheit und der Komfort zu, sondern auch die Gefahrenquellen hinsichtlich eines etwaigen Brands. Die Anzahl der Brände mit elektrischer Ursache ist immer mehr am Wachsen, der klassische Zimmerbrand durch eine vergessene Kerze hat beinahe »ausgedient«.
Besonders tückisch bei Elektrobränden ist zumeist die schleichende Entstehung – Elektrobrände bleiben daher oft lange unbemerkt und haben viel Zeit sich auszubreiten. Zum einen ist die Brandgefahr beim Laden der Akkus am höchsten, dies passiert auch meistens in der Nacht. Zum anderen geht von defekten und alten Akkus, zum Beispiel bei einem ausrangierten Notebook und einem »verunfallten« Scooter, eine sehr hohe Brandgefahr aus. Zusätzlich werden diese oftmals in weniger frequentierten Bereichen wie im Keller, der Garage oder mit einerMenge anderer Lagerungen aufbewahrt.
Als Ehrenrettung für die Batterien und Akkus muss natürlich aber ebenso erwähnt werden, dass deren Verwendung bei einem sorgsamen Umgang prinzipiell sicher ist. Dennoch ist es wichtig, einige Regeln und Vorsichtsmaßnahmen zu beachten:
- Setzen Sie auf Qualität. Mangelhafte Produkte sind mögliche Gefahrenquellen.
- Setzen Sie Akkus keinen extremenTemperaturen (+40 Grad bzw. -10 Grad) aus.
- Sie nutzen ein Gerät nur selten, lagern Sie Altgeräte? Entfernen Sie den Akku und lagern Sie ihn separat, vor allem aber kühl und trocken.
- Nehmen Sie Beschädigungen ernst! Ein Akku kann leicht einmal hinunterfallen oder eingeklemmt werden. MechanischeBeschädigungen stellen ein erhöhtes Risiko dar.
- Wenn Sie Verformungen, Erhitzung, Verfärbung oder ungewöhnlichen Geruch wahrnehmen, lassen sie den Akku überprüfen. Das Gerät nicht in Betrieb nehmen!
- Verwenden Sie zum Laden ausschließlich vom Hersteller:innen freigegebene Ladegeräte und Kabel.
- Geräte beim Aufladen immer auf einen nicht brennbaren Untergrund legen.
- Vermeiden Sie das vollständige Ent- und Aufladen des Akkus. Laden Sie ihren Akku stattdessen frühzeitig nach.
- Stecken Sie ihre Ladegeräte und auch Steckerleisten (Kippschalter) ab, wenn sie diese nicht verwenden. Das spart Strom und reduziert die Brandgefahr.
- Verwenden Sie keine defekten, beschädigten, verformten oder aufgeblähten Batterien und Akkus.
- Lagern und laden Sie Akkus nicht im Außenbereich, nicht in feuchten Räumen sowie nicht an Orten, an denen sehr hohe Temperaturen zu erwarten sind (beispielsweise im Gartenhaus oder hinter der Windschutzscheibe im Auto).
- Batterien und Akkus (auch beschädigte) gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie Altbatterien und Altakkus sachgerecht in den Sammelboxen im Handel oder bei kommunalen Sammelstellen.
- Kleben Sie die Pole vor der Entsorgung ab. So verhindern Sie einen Kurzschluss.
- Bei längerer Lagerung, zum Beispiel bei der Überwinterung des Akkurasenmähers, empfehlen die meisten Hersteller:innen einen Ladestand von ca. 40-50 %.
- Als Vorsichtsmaßnahme können Sie Rauchmelder in Ihren Räumlichkeiten installieren.
- Keinesfalls sollten Sie Batterien und Akkus im Kühlschrank lagern und auch nicht der Feuchtigkeit aussetzen. Kommt Lithium mit Wasser in Kontakt, kann das ebenfalls zu Beschädigungen führen.
- Fassen Sie »schmierige« oder ausgelaufene Batterien und Akkus möglichst nicht mit der bloßen Hand an. Sollten Sie mit den ausgelaufenen Komponenten in Kontakt gekommen sein, waschen Sie sich gründlich die Hände.
Auch bei der größten Vorsicht und vorbeugendem Brandschutz kann es leider dennoch auch zu einem Brand kommen. Zögern Sie nicht unter 122 die Feuerwehr anzurufen. Für den ersten Löscheinsatz sind auch Handfeuerlöscher und Löschdecken sinnvoll.
An erster Stelle steht aber immer der Schutz und die Rettung von Menschenleben. Verlassen Sie den Brandbereich, materielle Werte können ersetzt werden.

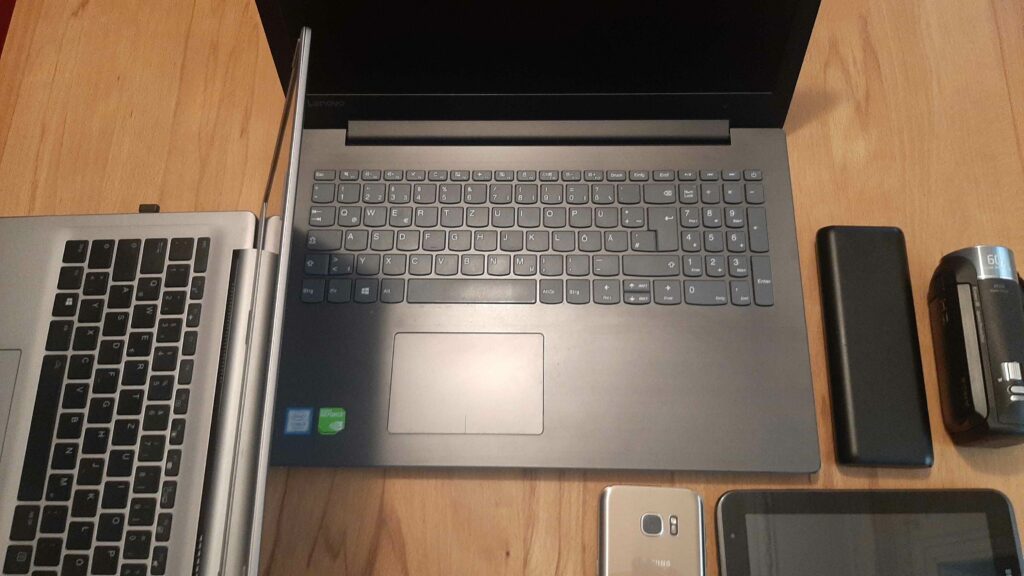
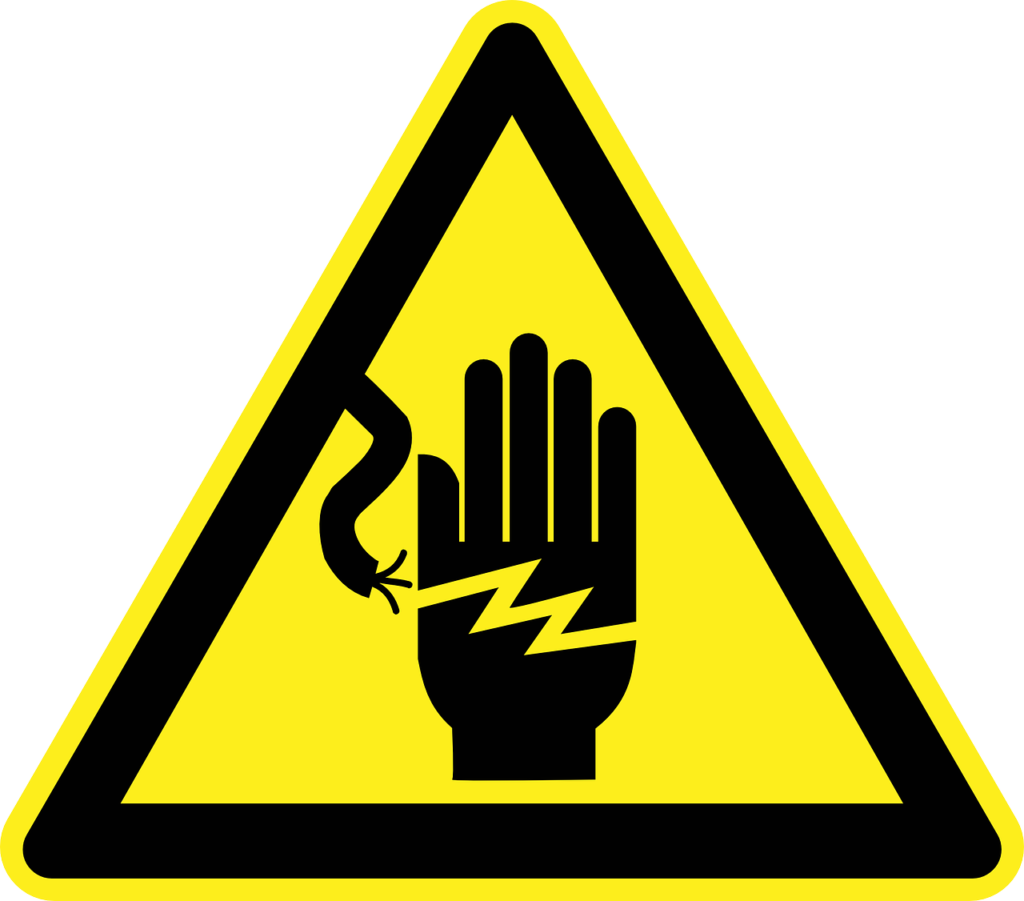














 begeistert und lauschen gespannt den Tönen, dann wieder wollen wir uns konzentrieren und der Vogel vor unserem Fenster raubt uns den letzten Nerv. Die Schwelle bzw. die individuellen Grenzen zwischen störendem Lärm und genussvoll erlebter oder gewünschter Geräuschkulisse werden immer vorhanden sein und damit wird eine zufriedenstellende Lösung zur Lärmreduktion bzw. -optimierung sehr komplex und oftmals nur mit einer vielschichtigen Lösungsstrategie und umfassender Einbeziehung der Beteiligten zu erreichen sein.
begeistert und lauschen gespannt den Tönen, dann wieder wollen wir uns konzentrieren und der Vogel vor unserem Fenster raubt uns den letzten Nerv. Die Schwelle bzw. die individuellen Grenzen zwischen störendem Lärm und genussvoll erlebter oder gewünschter Geräuschkulisse werden immer vorhanden sein und damit wird eine zufriedenstellende Lösung zur Lärmreduktion bzw. -optimierung sehr komplex und oftmals nur mit einer vielschichtigen Lösungsstrategie und umfassender Einbeziehung der Beteiligten zu erreichen sein. und ab 85dB verpflichtend verwendet werden, dies ist beim Arbeiten mit Maschinen sehr oft der Fall. Prinzipiell ist ein kollektiver Lärmschutz, also das Reduzieren von Lärm bzw. das Einhausen der Lärmquelle, dem individuellen Lärmschutz (Gehörschutz)aber vorzuziehen. Wie bereits oben erwähnt, sind speziell in Großraumbüros, neben der Bereitstellung von Rückzugsbereichen und Besprechungsräumen, schalldämmende Maßnahmen und begleitende Verhaltensregeln wichtig. Zusätzlich sind den Mitarbeiter:innen in Lärmbereichen unter bestimmten Voraussetzungen auch regelmäßige Untersuchungen der Hörfähigkeit anzubieten.
und ab 85dB verpflichtend verwendet werden, dies ist beim Arbeiten mit Maschinen sehr oft der Fall. Prinzipiell ist ein kollektiver Lärmschutz, also das Reduzieren von Lärm bzw. das Einhausen der Lärmquelle, dem individuellen Lärmschutz (Gehörschutz)aber vorzuziehen. Wie bereits oben erwähnt, sind speziell in Großraumbüros, neben der Bereitstellung von Rückzugsbereichen und Besprechungsräumen, schalldämmende Maßnahmen und begleitende Verhaltensregeln wichtig. Zusätzlich sind den Mitarbeiter:innen in Lärmbereichen unter bestimmten Voraussetzungen auch regelmäßige Untersuchungen der Hörfähigkeit anzubieten.

