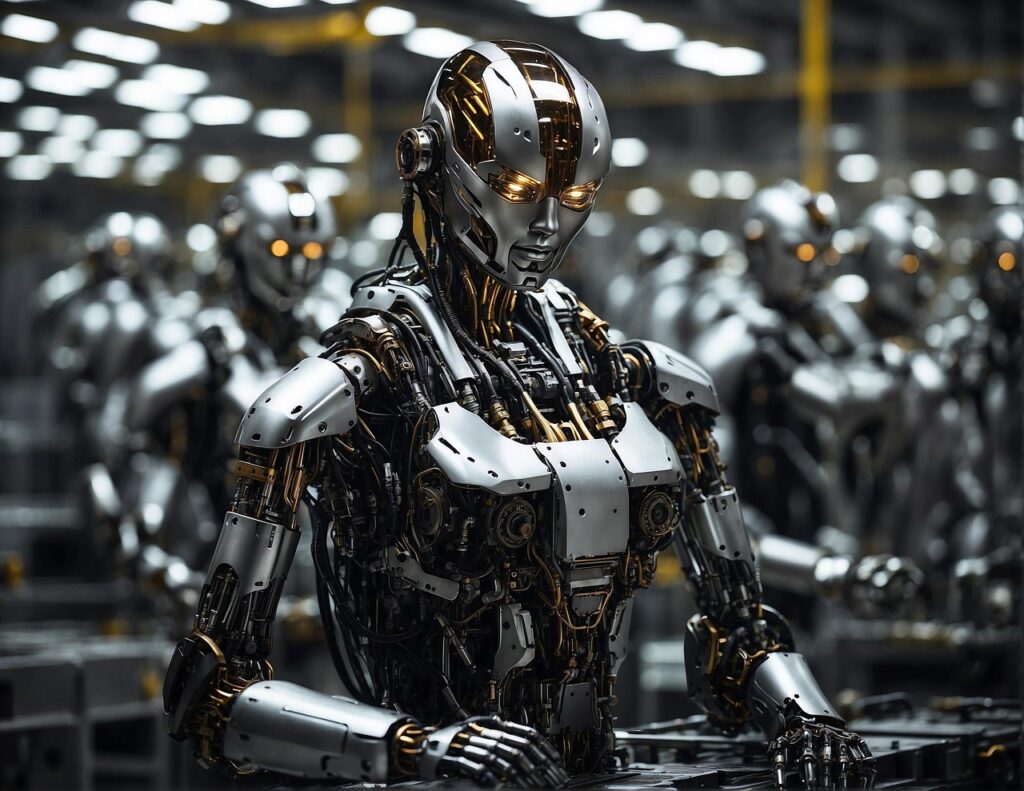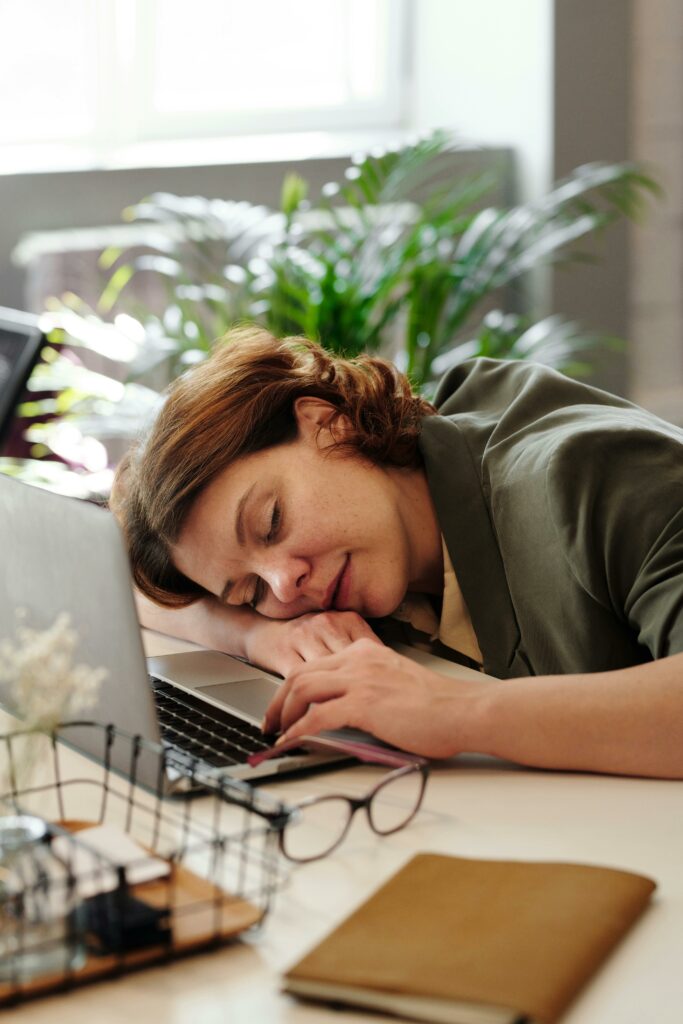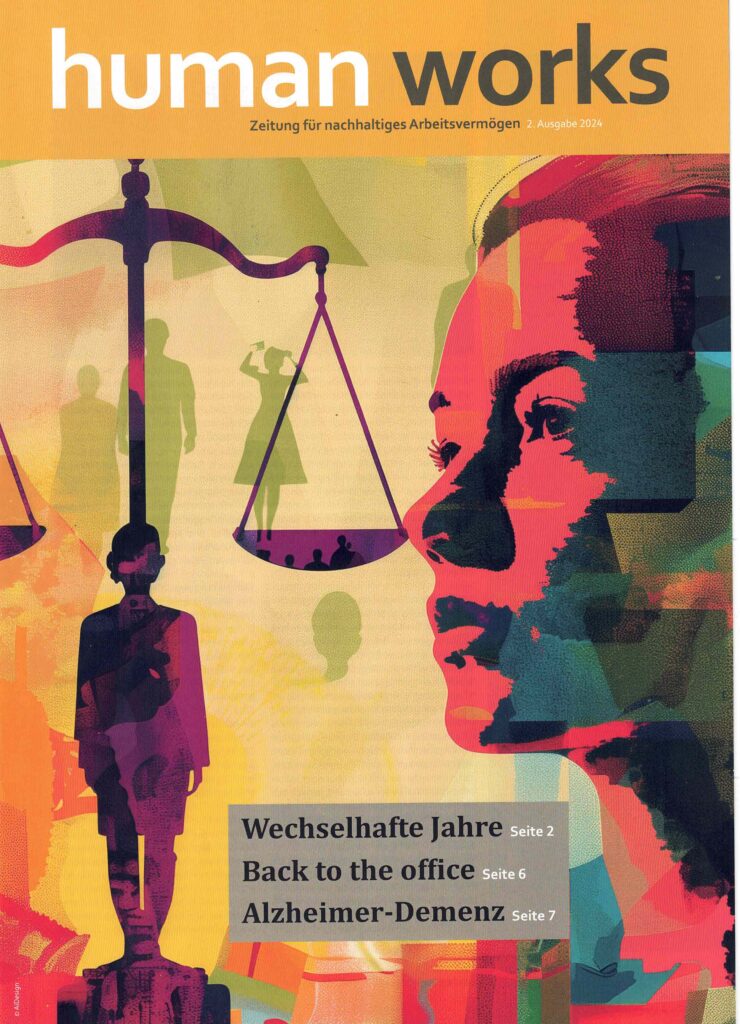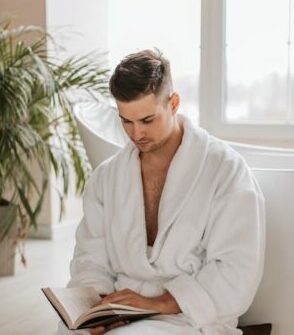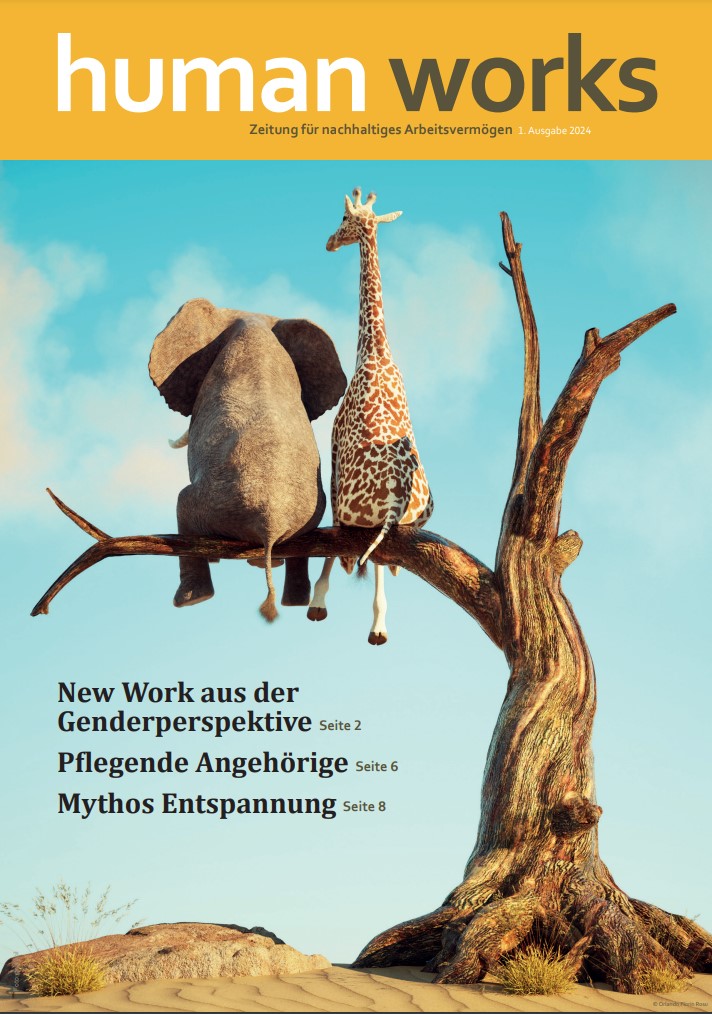IBG-Geschäftsführer Gerhard Klicka im Gespräch über New Work, betriebliche Gesundheitsförderung und die Zukunft der Arbeit.
Heuer feiert IBG ihr 30-jähriges Bestehen – eine lange Zeit in einer sich rasant wandelnden Arbeitswelt. Ist der Hype um »New Work« berechtigt?
Die Arbeit hat sich enorm verändert. Als ich begonnen habe, gab es noch zwei Unternehmen: IBG, das sich mit Beratung beschäftigte, und Worklab, das den Arbeitnehmer:innenschutz abdeckte. Worklab war damals eher ein Netzwerk von Arbeitsmediziner:innen, Psycholog:innen und Sicherheitsexpert:in nen – keine strikte Firmenstruktur, sondern ein offener Austausch. Mit der Zeit mussten wir uns aber professionalisieren. Durch das Zusammenführen der beiden Firmen wuchs IBG auf über 200 Mitarbeitende an mehreren Standorten – und die erforderten klaren Organisationsstrukturen.
Was »New Work« betrifft: Ich denke, wir haben sinnvolle Elemente übernommen. Viele unserer Außendienstmitarbeiter:in nen arbeiten ohnehin bei Kund:innen vor Ort, und im Innendienst hat sich Homeoffice als Ergänzung etabliert. Spannend ist aber, dass viele Mittarbeiter:innen nach der Pandemie wieder ins Büro zurückkehren wollten und wollen – weil der persönliche Austausch und das soziale Miteinander im Arbeitsalltag unersetzlich sind.
Unternehmen setzen zunehmend auf digitale Angebote – Stichwort Online-Schulungen, Remote-Beratungen. Wo steht IBG?
Wir sind gut aufgestellt. Digitale Formate ermöglichen uns, Unternehmen mit verstreuten Standorten besser zu erreichen. Gerade für Firmen mit Außendienstmitar beiter:innen, die selten an einem zentralen Ort sind, bieten Online-Schulungen und Videoinhalte eine völlig neue Zugänglichkeit.
Allerdings ersetzen Online-Formate nicht alles – persönliche Beratung bleibt in vielen Bereichen essenziell. Der Arbeitnehmer:innenschutz beispielsweise beruht nach wie vor auf gesetzlichen Grundlagen, die seit den 1990ern nur wenig verändert wurden. Hier geht es weniger um Digitalisierung als um fachliche Expertise.
IBG ist österreichische Pionierin in der betrieblichen Gesundheitsförderung. Wie gehen Unternehmen heute mit dem Thema um?
Früher mussten wir den Bereich aktiv in Unternehmen einbringen – heute ist Gesundheitsförderung selbstverständlich geworden. Große Firmen haben eigene Abteilungen dafür, sodass externe Beratung nicht mehr im gleichen Umfang gebraucht wird.
Dazu kommt: Die Österreichische Gesundheitskasse bietet mittlerweile viele dieser Leistungen kostenlos an – da kann ein privates Unternehmen kaum konkurrieren. Aber IBG hat sich darauf eingestellt: Wir konzentrieren uns jetzt auf spezialisierte Projekte, bei denen Unternehmen mit komplexen Fragestellungen auf uns zukommen.
Was macht Sie besser als die Konkurrenz?
Wir haben zwei große Stärken: Erstens unseren wissenschaftlich fundierten Ansatz. Wir betrachten Arbeit nicht nur aus der Perspektive des Schutzes, sondern auch als potenziellen Gesundheitsfaktor. Unser Ziel ist nicht nur »weniger Belastung«, sondern »gesunde Produktivität«.
Zweitens unsere Reichweite: Wir betreuen Kund:innen von Eisenstadt bis Bregenz mit einheitlichen Standards. Und mit unserem »Human Work Index©« haben wir ein Instrument, das uns erlaubt, Arbeitsbedingungen messbar zu machen.
Blicken wir auf die letzten 30 Jahre: Was waren die größten Meilensteine – und wo gab es echte Krisen?
Der größte Meilenstein war sicher die Fusion der beiden Unternehmen – ein Prozess, der anfangs nicht reibungslos verlief. Aber heute profitieren wir von dieser Struktur. Auf Kundenseite hatten wir immer wieder große Projekte, etwa das »Life«-Projekt mit der Voestalpine oder langfristige Kooperationen mit Banken und Industriebetrieben. Krisen gab es auch. Zum Beispiel der Wandel in der betrieblichen Gesundheitsförderung, als der Staat als kostenloser Mitbewerber auf den Markt kam. Aber wir haben uns neu positioniert und arbeiten heute gezielter an Speziallösungen.
Unternehmenskultur ist ein Modewort, das häufig beschworen wird. Was tun Sie für den Teamgeist?
Wir setzen auf kleine, regional organisierte Teams mit eigener Führungskraft. Dadurch fühlt sich niemand in der Anonymität eines Großunternehmens verloren. Zudem gibt es regelmäßige Team-Events, die den Zusammenhalt stärken – von Sportaktivitäten bis zu gemeinsamen Festen.
Natürlich ist nicht alles perfekt. Ein wachsendes Unternehmen bedeutet auch, dass manche Mitarbeiter:innen sich fragen: »Wo bleibt der persönliche Bezug, wenn die Firma immer größer wird?« Aber genau deshalb setzen wir auf diese kleingliedrigen Strukturen.
Gibt es den typischen IBG-Mitarbeitenden?
Ja und nein. Alle Menschen sind individuell verschieden und das ist gut so. Aber ich respektiere und suche Persönlichkeit. Fach wissen kann man lernen, aber ob jemand ins Team passt, ist entscheidend. Wir legen Wert darauf, dass neue Mitarbeiter:innen nicht nur fachlich gut sind, sondern auch teamfähig und eigenständig arbeiten können. Unsere Fluktuation ist niedrig – was zeigt, dass wir in der Auswahl meist richtig liegen.
Viele Unternehmen sprechen von flachen Hierarchien, aber in der Praxis sieht es oft anders aus. Wie transparent sind Ihre Entscheidungen?
Transparenz ist mir sehr wichtig. Ich treffe keine einsamen Entscheidungen, sondern beziehe mein Team ein. Natürlich gibt es Hierarchien – aber entscheidend ist, dass Mitarbeiter:innen verstehen, warum eine Entscheidung getroffen wurde. Ich sehe mich als Dirigent: Mein Job ist es, sicherzustellen, dass alles harmonisch zusammenspielt.
Es ist Ihre Aufgabe, anderen Unternehmen Aufgaben wie Unternehmenskultur nahe zu bringen: Ist IBG selbst eine attraktive Arbeitgeberin?
Unbedingt, wenn ich zu Eigenlob greifen darf. Neben einem guten Betriebsklima sind es die Flexibilität und Eigenverantwortung, die wir bieten. Wer sich gut organisiert, hat große Freiheiten. Wir setzen nicht auf Micromanagement, sondern auf Vertrauen.
Viele Unternehmen sprechen von flachen Hierarchien, aber in der Praxis sieht es oft anders aus.
Wie transparent sind Ihre Entscheidungen? Transparenz ist mir sehr wichtig. Ich treffe keine einsamen Entscheidungen, sondern beziehe mein Team ein. Natürlich gibt es Hierarchien – aber entscheidend ist, dass Mitarbeiter:innen verstehen, warum eine Entscheidung getroffen wurde. Ich sehe mich als Dirigent: Mein Job ist es, sicherzustellen, dass alles harmonisch zusammenspielt.
Nach mehr als zwei Jahrzehnten Verantwortung für IBG: Was macht Ihren Job noch spannend?
Die Freude daran, IBG weiterzuentwickeln. Es gibt immer Luft nach oben – sei es durch neue Technologien, bessere Prozesse oder optimierte Arbeitsbedingungen. Themen wie Künstliche Intelligenz werden in Zukunft eine große Rolle spielen, und es ist spannend, wie wir das in unsere Arbeit integrieren können.
Wie sieht es mit der Zukunft der Branche aus?
Die Arbeitswelt wird sich in den nächsten Jahrzehnten radikal verändern. Automatisierung und KI werden immer mehr übernehmen – das wird auch den Arbeitnehmer:innenschutz betreffen. Gleichzeitig wird es Berufe geben, die Maschinen nie ersetzen können, etwa im Pflege- oder Sozialbereich. Die Frage wird sein: Wie passt sich der Arbeitnehmer:innenschutz diesen neuen Realitäten an? Das bleibt spannend.