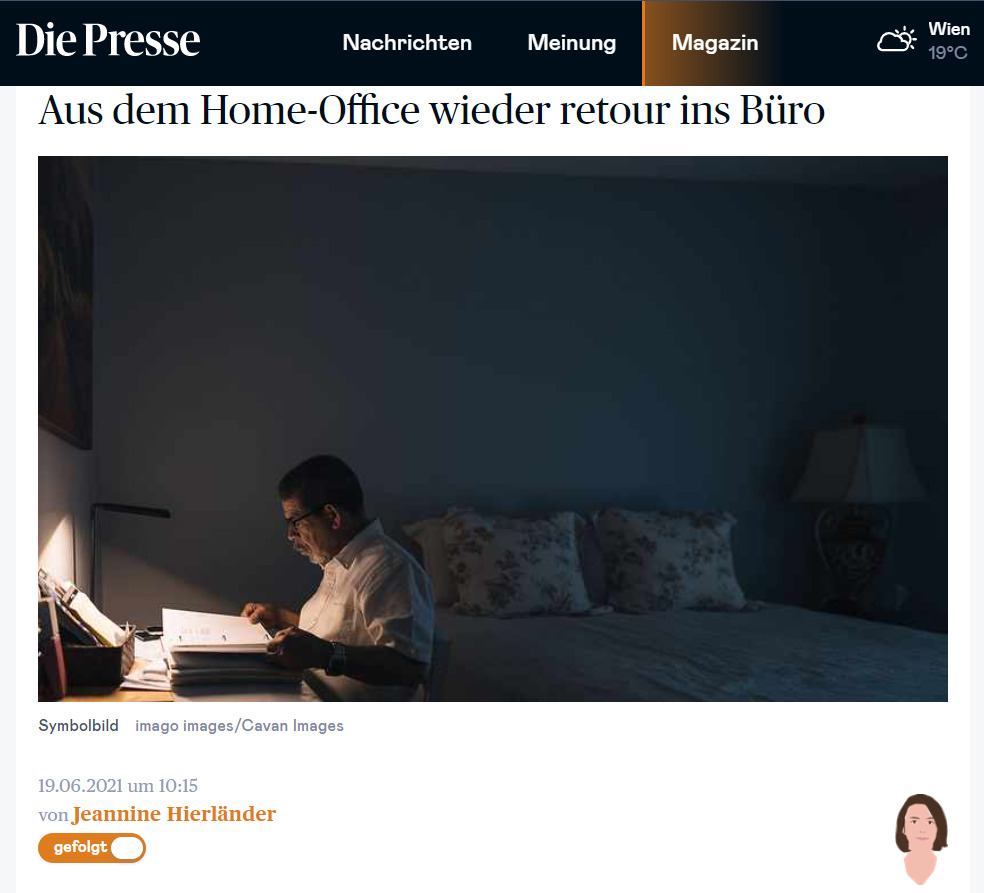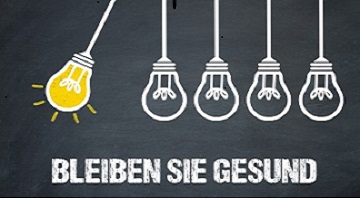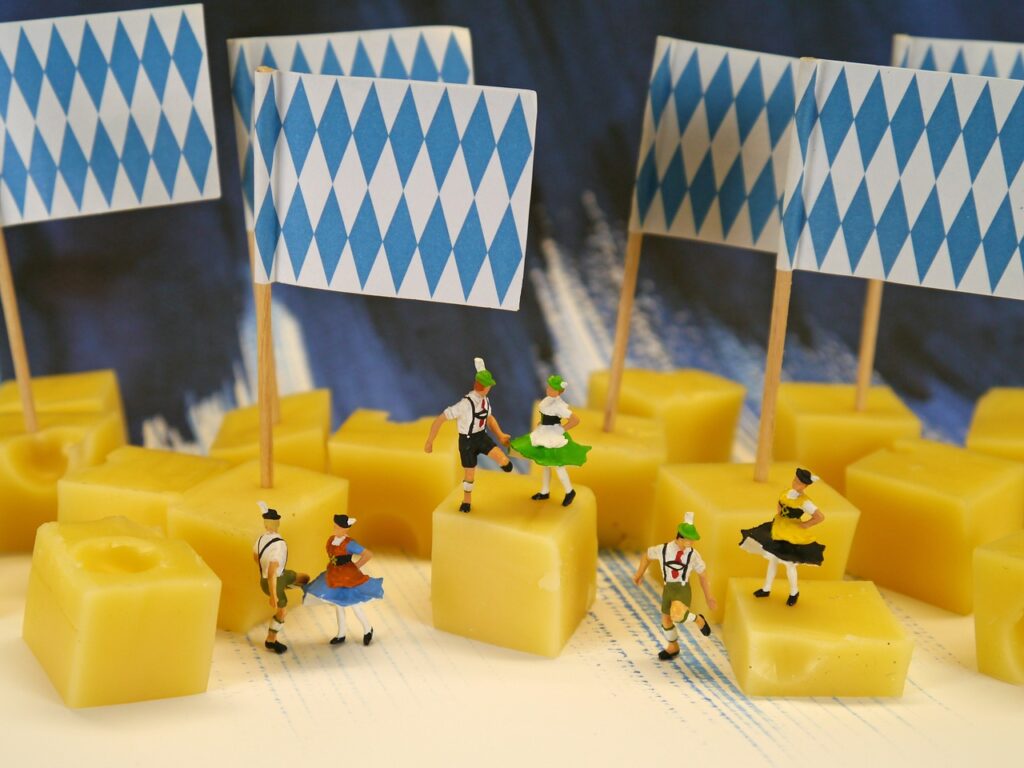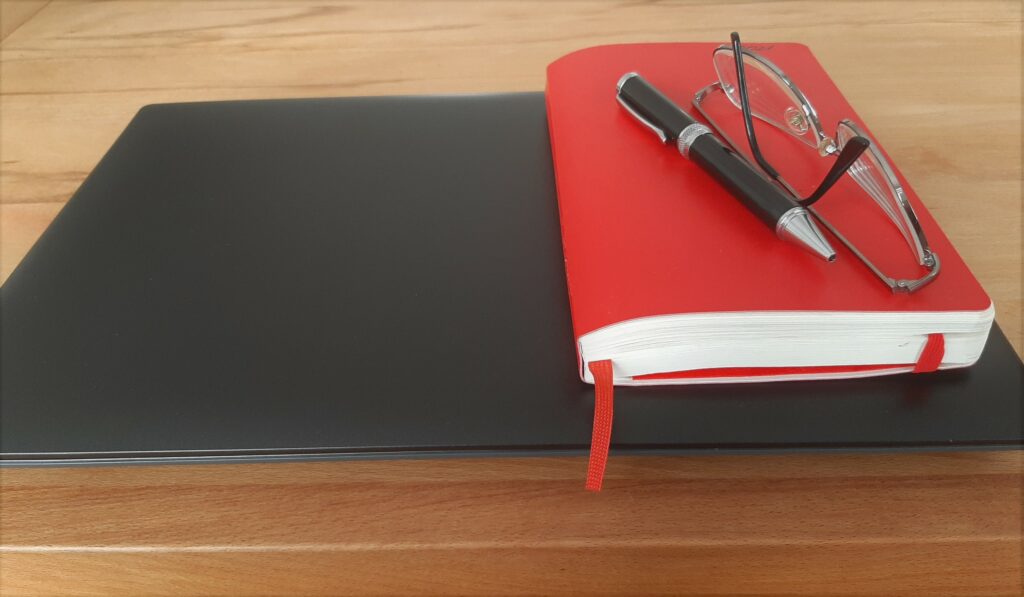Krankenstände und vorzeitige Berufsunfähigkeit aufgrund psychischer Erkrankungen haben zugenommen. Dies ist nur die Spitze eines Eisbergs einer noch viel größeren Anzahl von Arbeitnehmer:innen, die sich ausgelaugt, erschöpft oder ausgebrannt fühlen – auch wenn sie nach außen hin funktionieren.
Die lange Erklärung
Die Bedingungen, unter denen es zu Burn-out und seinen Vorstufen kommt, sind:
- Arbeitsüberlastung,
- ständiger Zeitdruck,
- unklare Rollen und Aufgaben,
- Unfairness,
- mangelnde Wertschätzung,
- nicht beachtete Konflikte,
- Benachteiligung,
- schlechte Kommunikation und
- Konflikte zwischen den eigenen Werten und denen des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin.
Ständiges Multitasking hat negative Auswirkungen auf die geistige Leistungsfähigkeit und die Stressverarbeitung: Man fängt vieles an und macht nur wenig fertig. Am Abend bleibt das Gefühl: „Wofür habe ich heute meine Energie verwendet?“ Dazu kommt noch die Hyperkommunikation: vor lauter E-Mails, Störungen und Meetings kommt man nicht mehr zu seiner eigentlichen Arbeit. Gleichzeitig hat man das Gefühl, an all dem nichts ändern zu können: Mitarbeiter:innen-Befragungen und Projekte zur Evaluierung psychischer Belastungen haben oft keine für den Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin sichtbaren Effekte. Der gesunde Mensch möchte in seiner Arbeit eigentlich nur eines: sinnvoll und effizient unter menschlichen Bedingungen arbeiten. Wenn ein/eine Arbeitgeber:in dies ermöglicht, braucht es meist keine Burn-out-Seminare.
Die kurze Erklärung
Die Geschichte des Kapitalismus zeigt, die Grundlage des heutigen Wirtschaftssystems ist Ausbeutung und Profitmaximierung in den Händen weniger. Die weltweite ökonomische Ungleichheit zwischen Gesellschaftsschichten hat in den letzten 20 Jahren ein nie dagewesenes Ausmaß erreicht.
Was können wir tun?
Was kann der/die Einzelne tun? Achten Sie auf Ihre Grenzen und Rechte. Informieren Sie sich und holen Sie sich frühzeitig Unterstützung bei der Belegschaftsvertretung, Arbeitsmediziner:innen und anderen Stellen. Achten Sie auf Ihre Rechte und Ihre Gesundheit. Versuchen Sie persönliche Wege zum Erhalt Ihrer körperlichen, psychischen und sozialen Gesundheit zu finden.
Was können wir gemeinsam tun? Die Wahrheit aussprechen! Ungleichheit nicht akzeptieren. Denn Handeln ist das beste Mittel gegen Angst, Lethargie und psychische Erschöpfung. Das Einzige, was uns zum Erfolg verhelfen kann, ist Kooperation.
Quelle: Univ.-Prof.Dr. Wolfgang Lalouschek,
Gesunde Arbeit Ausgabe 3/2020, www.thetree.at




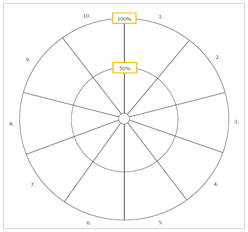 Nehmen Sie sich etwas Zeit und überlegen Sie, was Ihre großen Steine sind und welche Werte in Ihrem Leben wichtig sind.
Nehmen Sie sich etwas Zeit und überlegen Sie, was Ihre großen Steine sind und welche Werte in Ihrem Leben wichtig sind.